I. Einleitung
Noch vor zwanzig Jahren hat sich die Frage nicht gestellt. Der amerikanische Intellektuelle Francis Fukuyama meinte damals, dass nach dem Scheitern des Kommunismus kein weiteres glaubwürdiges, alternatives politisches Konzept Demokratie in Frage stellen und gefährden könne. Die Geschichte – als Wettstreit voneinander gegenüberstehenden politischen Leitbildern – wäre so zu ihrem Ende gekommen. Die Demokratie wäre nunmehr und für alle Zukunft unangefochten und weltweit die Norm, beziehungsweise das angestrebte Ziel. Francis Fukuyama hat damit ausgedrückt, was weithin als selbstverständlich angesehen wurde. Selbst der konservative und der Empirie verhaftete US-Politologe Samuel Huntington hat diese Sichtweise geteilt; wenngleich mit der Einschränkung, dass die Demokratisierung der Welt nicht ebenmäßig, sondern in Wellen verläuft, so dass jedem demokratischen Schub regelmäßig Rückschläge folgen. Aber auch Samuel Huntington hat nicht bezweifelt, dass sich der Kreis der Demokratien schlussendlich und in Summe weiten wird.
Europa und die USA haben darin gewetteifert, dieser Demokratisierung der Welt voranzuhelfen. Die USA wollten sie sogar mit Waffengewalt unterstützen. Sowohl Europa wie auch die USA waren überzeugt, mit ihrem weltweiten Engagement für Demokratie zum Wohle und im Sinne der betroffenen Bevölkerung zu handeln; und im Sinne einer langfristig unabwendbaren, die ganze Welt umspannenden Entwicklung. Das hat sich als Irrtum erwiesen. Demokratie ist weltweit im Rückzug. Der Raum der Demokratien schrumpft statt sich zu weiten. Es weitet sich stattdessen die Zahl der Nicht-Demokratien. Noch vor zwölf Jahren wurde nur die Hälfte der Weltbevölkerung autokratisch regiert; 2021 jedoch schon Zwei Drittel ( = 70 % ).[1]
Das ist schon vom rein Quantitativen weitaus mehr als der von Samuel Huntington prophezeite Rückschlag nach der „Dritten Welle“ der Demokratisierung.[2] Noch folgenschwerer als der quantitative Umfang dieser Rückentwicklung ist aber deren Natur. Der Abschied von Demokratie erfolgt heute nicht länger durch gewaltsamen Staatsstreich oder Militärputsch. Demokratien zerfallen vielmehr aus ihrem Inneren heraus. Der Prozess ist schleichend und führt über Stufen langsam abwärts. Aus konsolidierten Demokratien werden defekte, aus defekten Demokratien werden Schein-Demokratien („Fassaden-Demokratien“ ) und aus diesen schließlich autoritäre Regime.[3]
Zwar hat diese Entwicklung eine große Zahl von Staaten erfasst, die erst vor Kurzem zu Demokratien geworden waren, so wie etwa die Russische Föderation. Vor zwanzig Jahren war sie noch eine, wenn auch ein wenig defekte junge Demokratie. Unter Vladimir Putin ist sie rasch zu einer bloßen „Fassaden-Demokratie“ verkommen. Jetzt aber wird selbst der Anschein von Demokratie nicht länger aufrecht gehalten. Die Russische Föderation mutiert zu einer Autokratie. Aber nicht nur in „Jungen Demokratien“ erodiert Demokratie. Sie erodiert auch in seit Langem demokratischen Staaten, ja selbst in den USA und im Vereinigten Königreich, in Staaten also, von denen die weltweite Demokratisierung ursprünglich ihren Ausgang genommen hatte und obwohl man vermutet hatte, dass sich Demokratie dort infolge einer mehr als hundertjährigen Praxis so verfestigt hätte, dass sie für immer stabil und beispielhaft sein würde.
Österreich folgt diesem Trend. Auf dem von der University of Gothenburg erstellten Liberal Democracy Index, hat sich die Position Österreichs verschlechtert, nachdem sie schon vorher weniger gut war, als die der meisten anderen europäischen Staaten. So zählt Österreich auf diesem Index nicht zu den „Liberalen Demokratien“ („Liberal Democracies“). Es muss sich mit einem Platz auf der Liste von bloßen Wahldemokratien („Electoral Democracies“) begnügen.[4]
II. Die Zukunft der Demokratie
In seinem Buch Die Zukunft der Demokratie nennt Herfried Münkler vier Ursachen für diese demokratische Rückentwicklung („Democratic Recession“):
- Druck von außen durch nicht-demokratische Staaten.
- Soziale und wirtschaftliche Entwicklungen.
- Tiefgreifende Veränderungen in der Erschaffung und dem Austausch von Information.
- Modernen Demokratien offenbar innewohnende Kräfte der Selbstzerstörung.
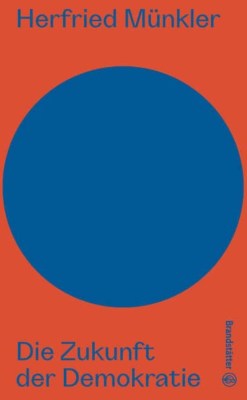
VON HERFRIED MÜNKLER
Wien: Brandstätter
200 Seiten | € 20,56 (Gebundenes Buch)
ISBN: 978-3710606519
Erscheinungstermin: Oktober 2022
Diese vier Faktoren haben unterschiedliches Gewicht. Sie beeinflussen und verstärken sich gegenseitig. Durch Druck von außen können Demokratien auf zweierlei Arten beschädigt werden. Erstens durch gezielte Aggression, so wie sie Russland durch Desinformation, Cyberangriffe, finanzielle Unterstützung anti-demokratischer Parteien etc. praktiziert. Solche feindlichen Eingriffe von außen haben negative Entwicklungen – wie den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union oder die Wahl des US-Präsidenten Donald Trump – zwar etwas, aber gewiss nicht entscheidend beeinflusst.
Weit wirksamer und nachhaltiger ist der „chinesische“ Weg der antidemokratischen Einflussnahme. Entgegen der herkömmlichen Meinung, dass wirtschaftliche und demokratische Entwicklung miteinander verknüpft wären und sich gegenseitig bestärken, hat China mit seinem spektakulären wirtschaftlichen Aufstieg bewiesen, dass dies nicht zutrifft, wobei es darüber hinaus sogar glaubhaft machen will, dass Demokratie nach westlichem Muster diese rasche wirtschaftliche Entwicklung sogar gehemmt hätte. China ist bemüht, der übrigen Welt diese seine Sicht der Dinge schmackhaft zu machen. Chinas wachsender Einfluss in Entwicklungsländern zeigt, dass es darin durchaus erfolgreich ist.
Dennoch ist Demokratie weltweit weniger durch China, Russland oder andere autokratische Staaten gefährdet als vielmehr durch den schwindenden Rückhalt in der Gesellschaft. Das ist einerseits Folge von wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen und andererseits Folge von Veränderungen in der Weise, in der sich durch Kommunikation Meinungen herausbilden und verfestigen. Demokratie kann sich nur entfalten, wo Staaten in der Lage sind, demokratische Entscheidungen wirksam umzusetzen. Das verlangt, dass Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt zu einer in sich geschlossenen Einheit verschmolzen sind. Diese Einheitlichkeit ist heute nicht länger gegeben. Heute verfügt kein Staat ausschließlich und allein über sein Territorium und über die auf ihm lebenden Bürger*innen. Die gegenseitige wirtschaftliche Durchdringung hat dieses Monopol unterlaufen. Augenscheinlich wird das am Beispiel des Internets,[5] durch das tief in die Lebenswelt der Bürger*innen und tief in die nationale Wirtschaft eingegriffen wird. Ein Staat kann solche Eingriffe nur teilweise regeln und kontrollieren. Diese Einengung der staatlichen Handlungsmöglichkeiten verknappt den Raum, in dem sich Demokratie entfalten kann.
III. Polarisierungen
Der für Demokratien wichtige gesellschaftliche Zusammenhalt lockert sich. Selbst wenn sie sich ernsthafter darum bemühen wollten, wird es Staaten kaum möglich sein, die eigentlichen Triebkräfte dieser Entsolidarisierung wirksam auszuschalten. Den Trend hin zu wachsender Polarisierung und wachsender Ungleichheit können Staaten nicht nach Belieben umkehren. Sie können ihn bestenfalls etwas abschwächen.[6] Denn Polarisierung und wachsende Ungleichheit ergeben sich aus der Natur der heutigen Weltwirtschaftsordnung. Diese wird weitgehend durch das Finanzkapital bestimmt, welches Einkommen und Vermögen zwangsweise ungleich verteilt. Ungleichheit befördert auch die Neuordnung des Arbeitsmarktes mit seiner Spaltung in einen Niedriglohn- und in einen Hochlohnsektor.
Die veränderten Kommunikationsmöglichkeiten und das veränderte Kommunikationsverhalten haben das Auseinanderfallen der Gesellschaft beschleunigt und verfestigt. Man trifft sich nicht länger auf einem Allen zugänglichen Platz (vergleichbar der griechischen „Agora“ auf der gemeinsam diskutiert und gemeinsam Beschlüsse gefasst wurden). Es gibt nicht länger einen die gesamte Gesellschaft einschließenden Diskurs. Unterschiedliche Gruppen diskutieren unter sich. Sie kümmern sich nicht und wissen nicht, was in anderen Gruppen besprochen wird. Die Folgen für die Demokratie sind fatal. Denn Demokratie hat zur Voraussetzung, dass es unter Bürger*innen Übereinstimmung darüber gibt, was als gegeben, was als wirklich hingenommen werden muss, und Übereinstimmung darüber, welche Aufgaben sich aus dieser Wirklichkeit ergeben.
Einst konnten anerkannte, weit verbreitete Printmedien[7] einen Konsens über die tatsächlichen Gegebenheiten herbeiführen, einen Konsens zumindest innerhalb der politisch maßgeblichen Elite. In der Ära des Internets ist das nicht länger möglich. Das Internet ersetzt die Realität. Was real sein soll wird via Internet von unterschiedlichen, voneinander abgeschotteten Gruppen beliebig definiert: Donald Trump hat die Wahlen gewonnen, Bill Gates injiziert Microchips in ahnungslose Menschen, mit einem Pferde-Anti-Wurm-Medikament lässt sich eine Ansteckung durch COVID verhindern, Putin führt keinen Angriffs-, sondern einen Verteidigungskrieg, die Armen sind an ihrem Schicksal selbst schuld etc.
IV. Vom Konsens
Dem Schwinden einer allen gleich zugänglichen Plattform für Diskurs und Konsensbildung entspricht der Niedergang von politischen Einrichtungen, in denen Diskurs konsolidiert und zu Konsens umgewandt werden konnte; und sodann von Konsens in allgemein verbindliche politische Entscheidungen. Die alten großen politischen Parteien hatten diese Funktion. Sie schwächeln. Die Zahl ihrer Mitglieder schrumpft. In hohem Maße sind Parteien zu einer sich selbst ergänzenden Oligarchie von Berufspolitiker*innen verkommen. Getrieben vom Alles überlagernden Interesse an Machterhalt und Machtgewinn, folgen politische Parteien zumeist nur mehr passiv einem von Meinungsumfragen und Boulevardmedien vorgegebenen Kurs. Gemeinsam mit einer Kaste von Beamt*innen in der höheren Verwaltung besorgen sie sodann die Umsetzung der laufend abgefragten öffentlichen Meinung in Gesetze. Bürger*innen können und wollen sich mit dieser Kaste von Berufspolitiker*innen nicht identifizieren. Wie Umfragen zeigen, werden Berufspolitiker*innen nicht geschätzt. Ein Parlamentsabgeordneter etwa rangiert im gesellschaftlichen Status und Rang weit hinter Ärzt*innen, Unternehmer*innen oder Fußballstars. Aber ohne wertgeschätzte Politiker*innen kann es auch keine wertgeschätzte Demokratie geben.
V. Pseudo-Politik und Gemeinwohl
Status und Selbstverwirklichung suchen viele politisch engagierte Menschen heute nicht länger durch Tätigkeit in Einrichtungen, die operativ in dem Sinne sind, dass sie Gesetze erzeugen. Sie flüchten stattdessen in die Pseudo-Politik der unterschiedlichsten Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs). Das schafft Statusgewinn, nicht zuletzt dadurch, dass sie sich damit von den als minderwertig erachteten Berufspolitiker*innen abheben. Politiker*innen müssen Kompromisse eingehen. Mitglieder einer NGO können solche Kompromisse als schmutzig ablehnen und damit ihr Ideal und ihre Identität vor Beschädigung durch irgendwelche Abstriche schützen. Protestierende, die sich auf der Baustelle einer Stadtstraße festkleben, sehen sich selbst als Helden und werden von der Öffentlichkeit zumeist auch als solche gefeiert. Der demokratisch gewählte Bürgermeister, welcher das seiner Meinung nach gemeinnützige Projekt der Stadtstraße umsetzten möchte, gilt demgegenüber als sturer, vorgestriger Betonkopf. Eine Vielzahl von Gruppen – NGOs, Interessenvertretungen, Sekten, Naturheiler, Internationale Großunternehmen, Technikgläubige und Fortschritts-Skeptiker – stehen im Grunde beziehungslos nebeneinander. Es gibt keine einende Sicht auf ein all diese Gruppen umfassendes Gemeinwohl.
Was für Gruppen gilt, das gilt auch für die Individuen. Auch ihnen mangelt es zunehmend am Verständnis für den Nächsten, an Empathie und Solidarität. Das ist letztlich das tiefer sitzende und grundlegendere Übel, an dem Demokratie erkrankt ist und das sie zersetzt. In schweren Krisen und bei großen Herausforderungen müssen Menschen zusammenstehen. Denn diese Krisen und Herausforderungen lassen sich nur in solidarischem Zusammenwirken bewältigen. In Zeiten von Krieg oder anders verursachter Not werden zum Beispiel Lebensmittel rationiert. Jeder und auch ein Reicher bekommt gleich viel, stillende Mütter und Schwerarbeiter*innen ein wenig mehr. In der Politik ist Zusammenarbeit gefordert und honoriert.
VI. Konkurrenz und Sozialpartnerschaft
Ist aber dann einmal satter Wohlstand gesichert, dann setzt sich in der Gesellschaft das Prinzip von Konkurrenz an Stelle von Solidarität. Der Nachbar, dem man einst in Zeiten von Not geholfen hatte, der wird nun zum Konkurrenten im Streben nach höherem und gesichertem Status: Sind die Kinder des Nachbarn in der Schule und im Beruf erfolgreicher? Hat er das größere Auto? Entspricht der eigene Konsum auch verlässlich den jeweiligen, von der allgegenwärtigen Werbung vermittelten Leitbildern? Die Ärmeren, denen man früher, in den schwierigen Zeiten noch willig geholfen hatte, mutieren nun zu einer Unterschicht, von der man sich distanziert, in die abzugleiten man befürchtet und die man, getrieben von solchen Abstiegsängsten, diskriminiert und verachtet.[8]
Ähnliches gilt für die Politik. Solange die großen Herausforderungen klar erkennbar und dringend sind, solange wird politische Zusammenarbeit honoriert. Politik wird dann von der Mitte bestimmt. Keine Partei würde es wagen, in der Kargheit einer Nachkriegszeit den Konsumzwang künstlich anzufachen. Sie würde es vermeiden, Zwiespalt zu säen zwischen den wohlhabenderen angeblichen „Leistungsträger*innen“ auf der einen Seite und den angeblich parasitären auf soziale Hilfe angewiesenen ärmeren Teilen der Bevölkerung. Sie würde auch nicht verlangen, dass Reiche, angeblich zum Wohle der Wirtschaft, im Verhältnis zu ihren Einkommen weniger Steuern entrichten als Angehörige der Mittelschicht. Verschwimmt aber dann mit wachsendem Wohlstand und zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung die Sicht auf einigende, große Aufgaben, dann folgt Politik nicht länger den Interessen und Ansichten der gesellschaftlichen Mitte. Stattdessen wird sie von den lautstarken Kräften an den radikaleren Enden des politischen Spektrums bestimmt. Identitätspolitik ersetzt Sachpolitik.
Klar zeigt sich das in der „Nachkriegsgeschichte“ Österreichs. Als es galt, die Schäden des Krieges zu beseitigen, wirtschaftlich aufzuholen, „europareif“ zu werden und im Ost-West-Konflikt nicht aufgerieben und geteilt zu werden, da war die Politik durch die Koalition der beiden großen Massenparteien und durch die Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmer*innen und Arbeiter*innen bestimmt. Dann aber, in der Ära des neu erreichten Wohlstands, zerbrach die Koalition zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Die beiden ehemaligen Großparteien verloren Mitglieder und Wähler*innen. Gleichzeitig haben sie sich im Kampf um die Gunst der Bürger*innen stärker profiliert und voneinander abgesetzt. Politik mutierte von einem Miteinander zu einem – oft schauspielhaften – Gegeneinander.
Dabei gerieten nicht nur in Österreich Traditionsparteien und mit ihnen die gesamte Politik verstärkt in den Sog von neu entstandenen Parteien und vornehmlich von Parteien am extremeren rechten Ende des politischen Spektrums. Es gab daher nicht nur in Österreich, sondern in fast sämtlichen reifen Demokratien einen Rechtsruck[9] bis hin zur demokratiegefährdenden, national-populistischen Absage an Modernität. Das Zukunftsgerichtete, das Progressive, das Optimistische, Gestaltungsfreudige trat in den Hintergrund zugunsten der Sorge um Erhalt des Bestehenden oder sogar der Sehnsucht nach Rückkehr zu einer idealisierten von Globalisierung, Multikulturalismus und dem Zustrom unerwünschter Ausländer*innen noch „unverschmutzten“ Vergangenheit.
Die Abkehr von Modernität, die Sehnsucht nach Rückkehr zur besseren Vergangenheit, dieses Misstrauen gegenüber den politischen und administrativen Eliten, dieses Abgleiten ins Rechtsextreme ist emotional aufgeladen. Gewaltbereitschaft ist latent vorhanden. Manchmal hat sie sich bereits in Taten umgesetzt: zum Beispiel im Sturm auf das amerikanische und das brasilianische Parlament und in den von Gewalt begleiteten Demonstrationen in Frankreich. Was treibt Menschen zu solcher Missachtung gesellschaftlicher Grundwerte und zur auflodernden Wut gegen demokratisch legitimierte Einrichtungen? Sind sie denn nicht Nutznießer*innen einer lange Zeit friedlichen, von Demokratien geleiteten Entwicklung, in der sich Wohlstand vervielfacht hat, in der sich die durchschnittliche Lebenserwartung um mehr als ein Jahrzehnt verlängert hat, in der die Bürde schwerer Arbeit leichter wurde und in der sich mehr Menschen als zuvor bilden und weiterbilden konnten?
VII. Conclusio
Aber offensichtlich hat all das wenig Gewicht im Vergleich zu einer tiefen Enttäuschung von hohen Erwartungen, der Entfremdung von einer Welt deren Komplexität Bürger*innen erahnen, fürchten und negieren wollen und der als beleidigend empfundenen Missachtung eines Anspruchs auf Anerkennung und Wertschätzung. Diese Enttäuschten, Verbitterten und Gewaltbereiten sehen sich nicht als Bürger*innen, welche aktiv über demokratische Einrichtungen den Weg der Gesellschaft bestimmen können. Sie sehen sich also nicht als „DEMOS“, als das Volk, welches der eigentliche Herrscher und Machthaber sein sollte. Sie sehen sich vielmehr als Opfer einer ihnen fernen, fremden, ihnen missgünstigen und sie verachtenden Elite. Das wohl nicht ganz zu Unrecht, denn die notwendige Komplexität der administrativen und politischen Steuerung des Gemeinwesens macht politische und administrative Entscheidungen für einen Großteil der Bürger*innen unverständlich. Die alten Parteien sollten einst die Kluft zwischen den politischen und administrativen Eliten und den Bürger*innen überbrücken. Dieser Aufgabe werden die jetzigen Parteien, unter den jetzt gegebenen Umständen, nicht gerecht. Der Demokratie ist ihr eigentlicher Souverän – der DEMOS, das selbstbewusste Wahlvolk – abhandengekommen. Wähler*innen werden von ihren Mandatar*innen hofiert, geködert, bestochen. Aber ihrer eigentlichen Pflicht, die großen politischen Linien festzulegen, können die Wähler*innen nicht nachkommen.
Lässt sich das reparieren? In seinem Buch über Die Zukunft der Demokratie schlägt Herfried Münkler dazu vor, Entscheidungen auf die untere politische Ebene zu verlagern – etwa zu Gemeinden – wo die Distanz zwischen Wähler*innen, Mandatar*innen und der Verwaltung kleiner ist und wo man sich daher nicht gegenseitig entfremdet. Er geht dabei so weit, dazu auch eine teilweise Entmachtung der Europäischen Union zugunsten von Staaten, Regionen und sogar Gemeinden vorzuschlagen. Das scheint wenig zielführend, denn die wirklich großen Probleme lassen sich nicht einmal von einem einzelnen Staat lösen, sondern nur im organisierten Zusammenwirken vieler Staaten.
Demokratie sollte wohl auf andere Weise repariert und gestärkt werden; etwa durch Einbeziehung von durch Los bestimmte und durch Expert*innen erweiterte Bürgerforen. Vor allem aber verlangt es nach einem Wandel der ins Seicht-Populistische verkommenen politischen Kultur. Das Handeln in Wahrheit, das Aussprechen von Wahrheit muss wieder zumutbar (so schon der deutsche Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt) und zur Regel werden.
THOMAS NOWOTNY
ist Politikwissenschaftler, Diplomat und Autor. Zwischen 1970 und 1975 war er Sekretär im Büro von Bundeskanzler Bruno Kreisky, seit 1994 ist er als Dozent an der Universität Wien tätig.
[1] Democracy Report 2022.
[2] Das war die Demokratisierung in Südeuropa, in Lateinamerika und in den einst kommunistischen Staaten.
[3] Varieties of Democracy project University of Gothenburg.
[4] Eine gleichlautende Aussage bringt der „Freedom of the World“-Index des US Freedom House.
[5] Große Internetfirmen – wie Facebook und Twitter – haben eigene, reichlich mit Personal ausgestattete Büros, die darüber verfügen, welche Meldungen auf ihren Plattformen nicht aufscheinen dürfen. Diese Büros wirken also wie die Zensurbehörden eines Staates, ohne dazu durch demokratisch entstandene Gesetze legitimiert zu sein.
[6] Das zeigt sich daran, dass selbst in Staaten mit hohen Sozialausgaben – wie Deutschland, Schweden und auch Österreich – die Ungleichheit in der Verteilung der Einkommen in den letzten Dekaden relativ stark zugenommen hat.
[7] Münkler nennt sie die „kuratierte Presse“, weil sie in der Obsorge von Journalist*innen stand, die sich „pro cura“ der Wahrheit verpflichtet fühlten.
[8] Der Rückgriff auf das Verhalten von Tieren ist zwar verpönt; aber im Hinblick auf die Evolution der Spezies Homo Sapiens dennoch naheliegend. Auch Menschen sind Herdentiere. Eine Herde von wilden Pferden verteidigt sich gemeinsam gegen ein angreifendes Wolfspack. Ist diese Gefahr dann abgewendet, kommt es wieder zu den periodischen Kämpfen um den Status im Rudel.
[9] Das bezeugen Entwicklungen in der ältesten Demokratie – den Vereinigten Staaten; Entwicklungen in der bevölkerungsstärksten Demokratie Indien; im Vereinigten Königreich ( der „ Mutter aller Parlamente“): in Frankreich; in Italien; und sogar in dem früher so linksliberalen Schweden


One comment
Comments are closed.